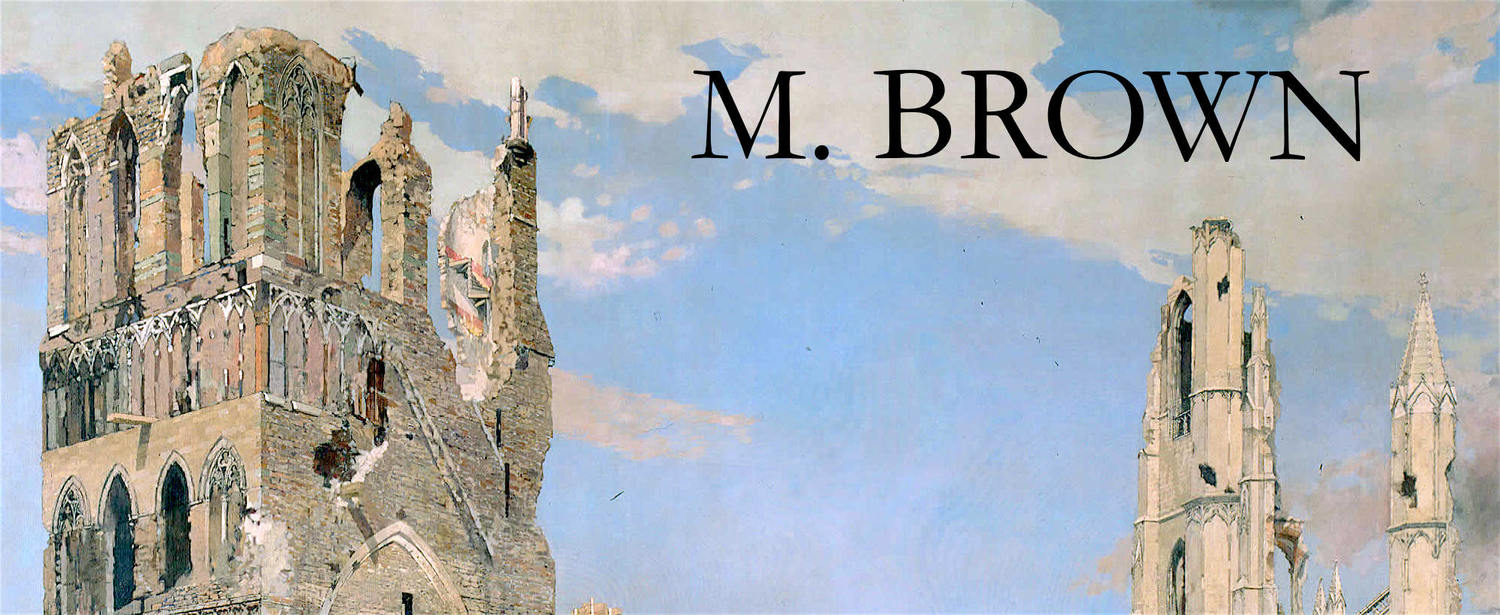Persephone
Wie die zu Wort
gewordene Stimme
solche Gitter braucht
rattern, so hallt
ihr Heulen im nächsten
Zimmer die Wand
zwischen uns
Hörenden, durch
die Resonanz
entzweit. Sind wir
nur, weil wir
aufgeteilt sind, du
und ich, oder ist unser
Hören wirklich ein
Warten auf Rückkehr
des fehlenden
Teils. Ein Phantom-
empfinden, der letzte Faden
Erinnerung an die
verlorene
Einheit außerhalb
dieser Räume, viel höher
als die Decke, die wir
getrennt teilen.
Tief in mir
sticht ihre Stimme
wortlos ein. Die Züge meines
Zimmers im Schallen
ihres wieder-
spiegelt. Mit meinen Händen
forme ich eine Schale,
eine Glocke um
mein Ohr, und drücke sie
gegen die Tapete.
Fast kann ich sie sehen,
die unbekannte
Nachbarin — wie
sie reglos da steht
im Kerzenlicht
und über ihr schwebt
im Schattenbahn
die Decke, befrachtet
voller Regen,
der sickert, fällt, fließt über
ihr Gesicht,
alles verschwommen
mit einem Weinen nicht
ihr eigenes. So
schaut sie
im Flackern meine
Vorstellung abgewandt
auf die Tapete,
diese dort abgebildeten
ländlich naïven
Szenen, wo immer die gleiche
Magd demselben
Schurken trifft
in Grüften, an halb-
zerfallenen Scheunen, Stränden,
im Gebüsch, unter Eschen,
Eiben und Palmen,
während die Züge, Glieder
dieser Zweien
schwellen, zerren, ver-
schmelzen wandab-
wärts glitschend
wie der Grund
sich löst, durchdrungen
im Flut niemandes
Tränen. Schwarz glänzt
ihr Haar, das ich auch nicht
sehen kann. Glänzt
wie die Nacht, wie der Frieden
eines Endes, und der Stern,
unzählig, der draußen
auf uns wartet.